Warum auswärts essen so teuer geworden ist – und was sich in der Gastrobranche ändern muss.
«Auch der Arbeitsmarkt ist ein Markt» war einer der prägnantesten Sätze eines Papiers des Kieler Instituts für Weltwirtschaft 2002. Es umfasst unter anderem 75 Punkte gegen die Arbeitslosigkeit und hatte zum Ziel, Arbeit billiger zu machen, möglichst viele Beschäftigte zu generieren und damit in Kauf zu nehmen, dass mehr Personen zu schlechteren Bedingungen und geringeren Löhnen arbeiteten. Die Arbeitgebenden stellten die Bedingungen, und die Arbeitnehmenden hatten sich anzupassen – es gab schliesslich genug von ihnen. Diese Zeiten sind vorbei.
Ich erinnere mich gut an mein erstes Vorstellungsgespräch für meinen Studentenjob: Nach einem flammenden Motivationsschreiben hatte ich der Personalchefin darzulegen, warum ich genau in diesem Unternehmen arbeiten möchte und was mich für den Job besonders auszeichnet. Meine Brandrede, in der ich die Vorzüge des Unternehmens und meine schnelle Auffassungsgabe pries, überzeugte, und so wurde mir gnädigerweise die Aufgabe zuteil, morgens um 4.30 Uhr vor den Vorlesungen Gipfeli aufzubacken und Sandwiches einzupacken für einen Stundenlohn, der als solcher kaum zu bezeichnen war. Diese Zeiten sind vorbei.
Noch heute arbeite ich neben meinem Nationalratsmandat in der Gastronomie, inzwischen aber in einem Restaurant, das mich überzeugt und hinter dem ich mit Leib und Seele stehe. Aber die Zeiten haben sich geändert. Wohin man schaut, in der Branche sucht man händeringend nach Personal, Servicekräfte und Köche sind Mangelware, und inzwischen sind es die Restaurants, welche die Vorzüge des Unternehmens vorbringen, um Mitarbeitende für ihren Arbeitsplatz zu gewinnen.
Teuer ist nicht das Rindsfilet oder der Kaisergranat, teuer sind die Arbeitsstunden, die in aufwendige und filigrane Teller investiert werden.
Das Machtgefälle hat sich zugunsten der Arbeitnehmenden verschoben: Sie stellen nun die Bedingungen, zu denen sie arbeiten möchten, und werden diese nicht erfüllt, findet sich mit Sicherheit ein Arbeitgeber, der besser passt. Im Niedriglohnsegment, zu dem die Gastronomie zählt, mangelt es an Fachkräften, die bereit sind, oft körperlich anstrengende Jobs bei 14-Stunden-Tagen und geringer Entlöhnung zu verrichten. Dem Beruf Kellner*in oder Koch/Köchin mangele es an Attraktivität, heisst es, es werden andere Arbeitszeiten und Saläre gefordert, was aus sozialer Sicht mit Sicherheit begrüssenswert ist.
Als Mitarbeitende in einem Restaurant kann ich die fehlende Attraktivität nicht bestätigen: Die Arbeit an sich, Menschen einen schönen Abend zu bereiten, Gastgebende zu sein, mit hochwertigen Lebensmitteln zu arbeiten und diese Philosophie auch an Gäste weiterzugeben – diese Arbeit ist in meinen Augen hochgradig erfüllend. Tatsächlich problematisch sind jedoch die Rahmenbedingungen in vielen Betrieben: lange Tage, geringes Gehalt bei anstrengender Tätigkeit, oft wenig Vereinbarkeit mit Familie und einem Sozialleben. In der Branche ruft man nach einer Attraktivitätssteigerung, 4-Tage-Wochen und höheren Löhnen – die Modelle sind vielfältig.
Als soziale Politikerin begrüsse ich all dies von Herzen. Als Gastronomiemitarbeitende jedoch bereitet es mir Bauchschmerzen. Kaum eine Branche kalkuliert so knapp wie die Gastronomie, und der Faktor Arbeit ist mit Abstand der teuerste in der Kalkulation. Nicht umsonst wird auch in Sternerestaurants trotz hohen Preisen oft kaum Geld verdient: Teuer ist nicht das Rindsfilet oder der Kaisergranat, teuer sind die Arbeitsstunden, die in so aufwendige und filigrane Teller investiert werden, was auch der Grund ist, weshalb ein gebackener Sellerie im Salzteig nur unwesentlich günstiger als das Rindsfilet ist: Der Arbeitsaufwand ist einfach massiv grösser.
Was also brauchen wir? Ich richte hiermit einen Appell nicht nur an die Branchenvertreter*innen, sondern auch an die Gäste: Wir brauchen bessere Arbeitszeiten. Wir brauchen höhere Gehälter in der Branche. Aber zuallererst brauchen wir eine Kommunikation von der Branche an die Gäste, warum ein Abend in einem Restaurant genauso viel kosten kann wie ein Konzert oder ein Theater. Wir bezahlen nicht den Steinbutt oder das fermentierte Wurzelgemüse. Wir bezahlen die Kreativität, die Zeit, den Platz und nicht zuletzt den Service, der uns den schönen Abend bereitet. Arbeit ist teuer, und das ist gut so.
Meret Schneider ist grüne Nationalrätin des Kantons Zürich.










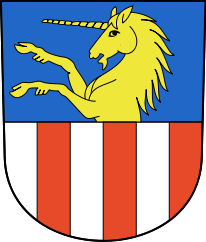
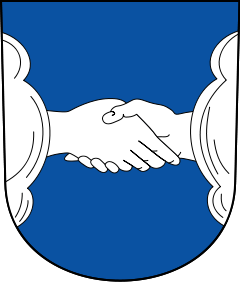


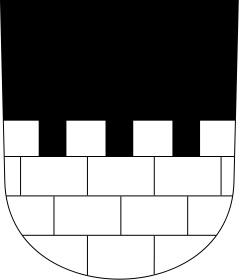

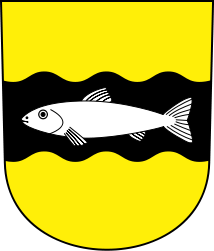
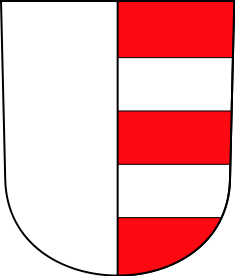
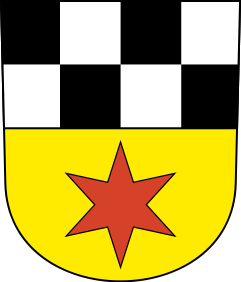


Kommentar verfassen